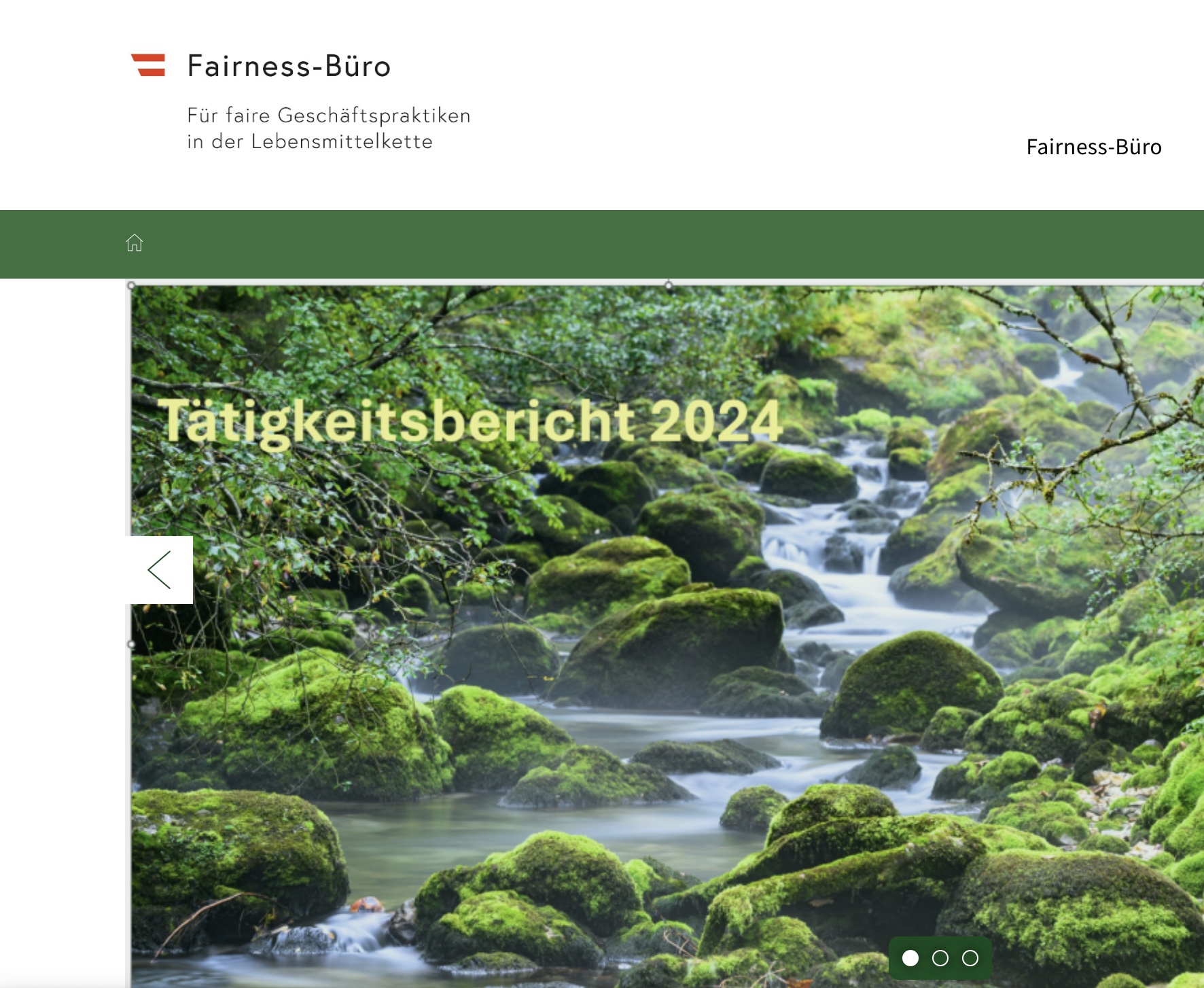Zur Macht im Agrar- und Ernährungsbereich – Interview mit Prof. Johanna Jacobi
| Faire Märkte Schweiz-Präsident führte mit Prof. Johanna Jacobi von der ETH Zürich ein Fachinterview. |
Faire Märkte Schweiz: Frau Prof. Johanna Jacobi, Sie lehren und forschen an der ETH Zürich im Themenbereich der agrarökologischen Transition und schauen besonders Themen der Machtverteilung in der Landwirtschaft und den Ernährungssytemen an, insbesondere im globalen Kontext. Wie wirken die Machtverhältnisse auf Produktion und Ernährungssysteme?
Prof. Johanna Jacobi: «Das zeigen die Forschungsarbeiten von Prof. Jennnifer Clapp aus Kanada oder früher schon vom Prof. McMichael von der Cornell University zu den «Food Regimes» sehr gut: Die enorme (und zunehmende) Konzentration der Macht im Agrar- und Ernährungsbereich beeinflusst die Märkte und ihre Dynamiken, Technologientwicklungen und Innovationen (bzw. auch was überhaupt als Innovation betrachtet und gefördert wird), sie beeinflusst die Politik und ihre Regeln und Massnahmen, sie beeinflusst auch die Forschungsthemen, also worüber überhaupt geforscht wird, nicht nur mit Geldern sondern auch mit Diskursen.
Das führt am Ende dazu dass Nahrung dorthin fliesst wo die Kaufkraft ist und nicht dorthin wo sie gebraucht wird, und dass die Produktion nach Nachfragen ausgerichtet werden die mit Bedürfnissen nicht viel zu tun haben. Die Folgen sind unter anderem Hunger, Mangelernährung, Übergewicht, Fettleibigkeit (eine sogenannte Syndemie), sowie die Zerstörung unserer Biosphäre und unseres Klimas.»
Faire Märkte Schweiz legt den Fokus gezielt auf den Missbrauch von Marktmacht sowie unfaire Handelspraktiken im Norden bzw. der Schweiz. Welche Rückschlüsse können aus Ihren Forschungsarbeiten für die Situation bei uns in der Schweiz gezogen werden?
Man könnte die Funktionsweisen und auch die Rollen der grossen Genossenschaften im Ernährungssystem innerhalb der Schweiz genauer anschauen: Coop, Migros, aber auch Fenaco und evtl. noch andere. Diese könnten das Ernährungssystem in eine nachhaltige Richtung lenken, da sie nicht wie rein profitorientierte Grossunternehmen funktionieren müssten.
Stattdessen stellen wir fest, dass sie in Krisenzeiten wie während der COVID-19 Pandemie Milliardengewinne machen, genau wie Cargill und andere Privatfirmen auf globaler Ebene. Das in Bezug auf das Ernährungssystem in der Schweiz, welches aber auch global verankert ist.
Es lohnt sich, die Futtermittelimporte genauer anzuschauen, Düngemittel, etc. die fast komplett importiert werden und die einen grossen ökologischen Fussabdruck haben. Im Land wird für die damit hergestellten «heimischen» Nahrungsmittel mit mehreren Millionen Franken staatlicher Unterstützung geworben. Das scheint mir nicht kohärent mit der Klimastrategie oder auch der neuen Ernährungsstrategie.
Aber es gibt sicher noch vieles mehr zu nennen. Holz, Palmöl, sogenannter nachhaltiger Fisch und die damit einhergehenden Nachhaltigkeitslabels die in wissenschaftlichen Forschungen als nicht nachhaltig kritisiert werden.
In meiner eigenen Forschung zu Soja in Bolivien und Brasilien habe ich dokumentiert, wie unterschiedlich die Diskurse der Agrarchemie- und Saatgutfirmen dort und hier sind. Hier spricht man von Reduktion und Effizienz von Pflanzenschutzmitteln, dort ist man stolz auf sie und empfiehlt viele Mittel, hohe Dosen und häufige Anwendungen – sogar von Substanzen die hier längst verboten sind. Oft sind die Agrarberater gleichzeitig Pestizidverkäufer für diese Firmen. Dass das zu einem höheren Pestizideinsatz führt, wurde von meinen Kollegen an der ETH Zürich kürzlich auch für die Schweiz nachgewiesen.
In einem Forschungsprojekte haben sie festgehalten, dass «das globale Ernährungssystem infolge politischer und marktstruktureller Machtgefälle in der Krise ist. Die Stimmen von Kleinbauern, Frauen und den Ärmsten der Armen werden zu wenig gehört». Haben diese Aussagen auch für die Bäuerinnen und Bauern und die kleinen gewerblichen Verarbeiter in der Schweiz ihre Gültigkeit?
Auch wenn im europäischen Durschnitt die Betriebe in der Schweiz eher klein sind und die familiäre Landwirtschaft mit vergleichbar hohen Subventionen gefördert wird, gibt es doch ähnliche Probleme: Der Zugang zu Land ist sehr ungleich, Frauen besitzen viel weniger Land als Männer, und Menschen die keines haben und nachhaltig Nahrung produzieren wollen, haben fast keine Chance Land zu bekommen. In politischen Diskurse, auf Agrarmessen und sogar in den Ausbildungen geht es fast nur um Produktivität von einigen wenigen Gütern. Das Motto «Masse statt Klasse» ist aber im Ernährungssystem nicht hilfreich, es führt zu schlechter Ernährung und nicht nachhaltigem Anbau. Alternativen werden aber leider immer noch viel zu wenig ernstgenommen bzw. gar nicht erst gesehen. Und wenn, wird gesagt, dass es nicht skalierbar sei. Dabei sind allein in Zürich hunderte von Haushalten mit Solawis oder Gemeinschaftsgärten verbunden, das bedeutet diese lokal, ökologisch und fair hergestellte Nahrung kommt bei tausenden Personen an. Es geht eben nicht darum ein Geschäftsmodell zu entwickeln aus dem dann die nächste Riesenfirma oder der nächste Supermarkt hervorgeht, sondern möglichst viele Menschen und möglichst viel Land in vielseitige Produktionssysteme einzubinden – an den Machtkonstrukten vorbei. Das ist für diese nicht lukrativ und wird daher auch nicht z.B. in der Wissenschaft und Politik ernsthaft diskutiert. Dabei gibt es unglaublich viele gute Beispiele, wie man jedes Jahr bei den Tagen der Agrarökologie sehen kann.
In einem Interview haben Sie gesagt, «die biologische Landwirtschaft funktioniert immer stärker in den schon bestehenden Wertschöpfungsketten und in Marktgesetzen, die ihr eigentlich komplett zuwiderlaufen. Doch nicht die ökologischen Gesetze müssen sich der Wirtschaft anpassen, sondern es muss umgekehrt gehen.» Bio Suisse ist derzeit gerade in einem Strategieprozess. Wie müssten ihre Aussagen in die strategischen Grundlagen von Biosuisse aufgenommen werden?
Ich denke, man muss den Bioanbau würdigen für das, was er geschafft hat und jeden Tag entgegen aller Schwierigkeiten leistet. Dass das existiert beweist ja schon, dass es auch anders geht. Aber man muss auch die Gefahr der Vereinnahmung sehen, durch die er sein Transformationspotential möglicherweise einbüsst und schlimmstenfalls genau das reproduziert, was man ursprünglich eigentlich verändern wollte: Abhängigkeit von Inputs und Grosshändlern, Krediten und Direktzahlungen, industrielle Monokulturen, kleine Höfe, die aufgeben müssen etc.
Also muss man ich überlegen: Was fehlt? Und ein grosses Thema ist sicher das sozio-ökonomische, das hingegen in der Agrarökologie sehr stark ist. Da könnte man zusammenkommen. Gerechtigkeit und Menschenrechte wären dann zum Beispiel präsenter, aber auch Ernährungstraditionen und Teilhabe an Entscheidungen. Es gäbe eine tiefere Auseinandersetzung mit jungen Menschen, Landrechten, die Ausbildungen – nicht parallel, sondern in Verbindung überall hineinstrahlend.
Die agrarökologische Transition basiert auf den Prinzipien der Agrarökologie. Zu den 13 Prinzipien, die die nötigen Veränderungen im Ernährungssystem umfassen, gehört auch „Fairness“. Faire Märkte Schweiz hat ein Forschungsprojekt ‚Was ist ein fairer Preis?‘ gestartet. Was können Sie zum Prinzip ‚Fairness‘ und fairen Preisen sagen?
Wir haben uns in unseren Forschungsprojekten wo ich beteiligt war viele Gedanken darüber gemacht. Eigentlich müsste es jeweils lokal festgelegt werden was ein «Living Income» ist.
Gute Ansätze gibt es mit der Gemeinwohlökonomie oder dem landwirtschaftlichen Leistungsrechner ja. Kostenwahrheit wird immer mehr zum Thema, das wirklich transformativ sein könnte – aber nicht einfach als Preisinformation auf dem Einkaufszettel im Supermarkt, sondern als Grundlage für Direktzahlungen oder das «Polluter Pays» Prinzip: Wer krebserregende Pestizide anwenden will, muss auch für Behandlungen mitbezahlen, und wer Leistungen erbringt die für die gesamte Gesellschaft wichtig sind wie – neben Nahrungsmittelproduktion – Biodiversitätsschutz, Klimaschutz oder Wiederherstellung der Bodenfruchtbarkeit, würde dafür entlohnt.
Heute laufen im Schweizer Detailhandel 80% der Waren über die beiden Grossverteiler. Wie würden Marktstrukturen in der Schweiz aussehen, die nicht nur fairer, sondern auch nachhaltiger sind?
Es gibt verschiedenste Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, die Supermärkte gemeinschaftlich / öffentlich zu organisieren, da man so immer noch den Vorteil hätte, vieles an einem Ort zu bekommen. Aber auch Quartiersläden wie die POTs sind interessant. Alles, was Produzierende und Konsumierende näher zusammenbringt.
Wie gesagt können auch Städte sehr produktiv sein! Man könnte die jetzige Produktion von Futtermitteln und Zucker hinterfragen und Anreize für andere Anbausysteme schaffen, zum Beispiel durch die öffentliche Hand (Gemeinschaftsverpflegung). Aus anderen Ländern wie Brasilien gibt es da sehr erfolgreiche Beispiele.
Derzeit ist die AP2030 in Entstehung. Was wünschen Sie sich für diese Reform wünschen?
Ich würde mir mehr verpflichtende Massnahmen wünschen, da die Evidenz für den Erfolg freiwilliger Massnahmen sehr schwach ist. Gleichzeitig wäre eine gezielte Förderung von kleinen Betrieben wichtig, da diese die Biodiversität durch ihre Vielseitigkeit besser schützen und die Schweiz nach wie vor jeden Tag im Durchschnitt zwei Höfe verliert. Aber am allerbesten wäre denke ich, wenn die AP partizipativ erarbeitet würde – und zwar nicht nur mit Lobbyist:innen sondern mit der Bevölkerung – und am besten gleich noch von der Agrarpolitik in eine Ernährungspolitik umgewandelt würde, die verschiedene Bundesämter verbindet und das ganze Ernährungssystem im Blick hat.
Das scheint vielleicht aufwändig, wäre aus meiner Sicht aber notwendig und würde sich wohl durch eine höhere Kohärenz, bessere Auswirkungen und Akzeptanz auszahlen. Der Bürger:innenrat für Ernährungspolitik hat dafür 2022 eine gute Grundlage gelegt, auch aus anderen Ländern gibt es immer mehr Beispiele wie solche Foren umstrittene Themen sinnvoll diskutieren und depolarisieren können.
Faire Märkte Schweiz geht von der Hypothese aus, dass nur mit faireren Märkten der Wandel hin zu nachhaltigen Märkten geschafft werden kann. Wie beurteilen Sie dies?
Da stimme ich zu. Gerechtigkeit ist Teil der Nachhaltigkeit, schon allein weil die Menschen die im Ernährungssystem arbeiten oft sehr geringe Löhne erhalten – und das sind ja die Personen die für eine Nachhaltigkeitstransformation essentiell sind.
Aber beides, ökologische Nachhaltigkeit wie sozio-ökonomische Gerechtigkei,t sind ja auch Teil der Nachhaltigkeitsziele welche alle Regierungen unterschrieben haben. Das ist also keine politische Seite oder persönliche Ansicht, sondern ein gemeinsames Ziel, auf das man sich die Weltgemeinschaft in langen Verhandlungen geeinigt hat.
Welchen Tipp geben Sie dem Verein Faire Märkte Schweiz für seine Arbeit?
Internationale Verflechtungen und historische Entwicklungen zu betrachten und zu diskutieren finde ich immer sehr erhellend. Zum Beispiel gab es früher garantierte Preise für bestimmte Produkte. In der Zeit der Marktliberalisierung wurden dann stattdessen die Direktzahlungen eingeführt – eine Unterstützung durch die öffentliche Hand, wodurch die verarbeitende Industrie günstigere Produkte bekommt. Das sind völlig verschiedene Ansätze, die man kritisch betrachten kann und schauen, welche positiven Aspekte von beiden man anwenden und welche nicht so positiven man weglassen könnte.
Dann ist für eine stärkere Stimme die Vernetzung wichtig mit anderen Organisationen und Gruppen, die ähnliche Ziele im Sinne von Fairness oder Nachhaltigkeit haben, wie Uniterre, die Vertretung von la Via Campesina in der Schweiz, was mit 200-300 Mitgliedern vielleicht die grösste soziale Bewegung der Welt ist, und die sich für Agrarökologie und faire, nachhaltige Ernährungssysteme einsetzt.
| Zur Person Dr. Johanna Jacobi ist Assistenzprofessorin für Agrarökologische Transitionen an der ETH Zürich. Nach Forschungsarbeiten an der Universität Bern über die Widerstandsfähigkeit von Kakaofarmen in Bolivien gegenüber dem Klimawandel und mehrjährigen Forschungsaufenthalten in Südamerika konzentrierte sich auf die Agrarökologie als transformative Wissenschaft, Praxis und soziale Bewegung sowie auf Machtverhältnisse in Nahrungsmittelsystemen mit Ansätzen und Methoden der politischen Ökologie. An der ETH Zürich hat sie ihre Forschungsthemen der Machtverteilung vertieft und zeigt auf, wie sich die Machtverhältnisse auf Produktion und Ernährungssysteme auswirken. |